 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
| |
| Martin Waldes Labyrinth und Türen |
 |
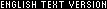 |
|
zum Unbekannten | Mami Kataoka |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
Begriffe: |
|
Martin Walde stellt uns immer wieder auf die Probe. Wie eine Falle, der wir nicht entgehen
können, konfrontiert er uns mit merkwürdigen Situationen und Phänomenen
und lockt uns in ein imaginäres Labyrinth. Dieses Labyrinth quillt über von fiktiven
Geschichten und aus-gefallen Ideen in der Art von ›Was wäre, wenn…‹. Einige davon
realisiert Walde, um unsere Reaktionen zu testen. Auf Basis dieser Reaktionen (oder
auch deren Ausbleiben) entwickelt er in einem kontinuierlichen Prozess von Versuch
und Irrtum die verschiedenen Materialen, Formen, Strukturen und Situationen immer
weiter. Auf diese Weise etabliert er sozusagen eine wortlose Kommunikation mit seinem
Publikum. |
|
|
 |
7 Doors (Storyboard) |
|
|
 |
Key Spirit |
|
|
 |
A Stream of Cream - Pumkin |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 Wenn zum Beispiel hinter einer fremden Tür ein Miauen zu hören ist, dann stellen
wir uns dort naturgemäß eine Katze vor. Aber was wäre, wenn vor der Tür viele Schlüssel
ver-streut lägen? Die meisten Betrachter würden darunter den zum Schloss passenden Wenn zum Beispiel hinter einer fremden Tür ein Miauen zu hören ist, dann stellen
wir uns dort naturgemäß eine Katze vor. Aber was wäre, wenn vor der Tür viele Schlüssel
ver-streut lägen? Die meisten Betrachter würden darunter den zum Schloss passenden
Schlüssel vermuten, und einige sich möglicherweise vorstellen, wie sie diesen tatsächlich
finden und einen Blick auf die Katze hinter der Tür werfen. Wenn sie aber,
der unwidersteh-lichen Versuchung folgend, den richtigen Schlüssel suchten und nach
einiger Mühe schließlich die Tür öffneten, dann befände sich dort anstelle einer Katze
lediglich eine weitere Tür. Kurz: sie wären direkt in eine von Martin Waldes Fallen
getappt. |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 In den Storyboards (1986 – 1993) tauchten die Zeich-nungen von Türen gelegentlich
auf. (Siehe 7 Doors, Storyboard, 1988.) Dieses Tür-Motiv stellt die Grundidee von Key Spirit dar und verkörpert als solches
Martin Waldes »Was wäre, wenn…«-Labyrinth, einen imagi-nären Raum, in dem
der Künstler alle seine Ideen seit den 1980er Jahren lagert. Seitdem
hat sich das Motiv der Tür kontinuierlich weiter entwickelt: mal als orange Flüssigkeit
(Kürbisbrei), die unter einer Tür herauszufließen scheint, mal als Zeichnung von mehreren
Türen hintereinander, bis hin zu labyrinthischen Zeichnungen endloser Folgen
von Türen. (Siehe: A Stream of Cream - Pumkin, 1993) In den Storyboards (1986 – 1993) tauchten die Zeich-nungen von Türen gelegentlich
auf. (Siehe 7 Doors, Storyboard, 1988.) Dieses Tür-Motiv stellt die Grundidee von Key Spirit dar und verkörpert als solches
Martin Waldes »Was wäre, wenn…«-Labyrinth, einen imagi-nären Raum, in dem
der Künstler alle seine Ideen seit den 1980er Jahren lagert. Seitdem
hat sich das Motiv der Tür kontinuierlich weiter entwickelt: mal als orange Flüssigkeit
(Kürbisbrei), die unter einer Tür herauszufließen scheint, mal als Zeichnung von mehreren
Türen hintereinander, bis hin zu labyrinthischen Zeichnungen endloser Folgen
von Türen. (Siehe: A Stream of Cream - Pumkin, 1993) |
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 1997 schließlich wurde Key Spirit erstmals als Installation in einer Ausstellung im W139 in Amsterdam verwirklicht. Das Konzept sah vor, dass die Besucher durch eine Tür in einen Raum eintreten konnten, in dem von Innen ein Schlüssel steckte. An anderen
Orten wurde dies Konzept aus Sicherheitsgründen abgelehnt. In der Folge variierte
die Zahl von Türen von Ausstellungsort zu Ausstellungsort oder die Geschichte
wurde auch durch das Miauen der Katze hinter der Tür anders erzählt. 1997 schließlich wurde Key Spirit erstmals als Installation in einer Ausstellung im W139 in Amsterdam verwirklicht. Das Konzept sah vor, dass die Besucher durch eine Tür in einen Raum eintreten konnten, in dem von Innen ein Schlüssel steckte. An anderen
Orten wurde dies Konzept aus Sicherheitsgründen abgelehnt. In der Folge variierte
die Zahl von Türen von Ausstellungsort zu Ausstellungsort oder die Geschichte
wurde auch durch das Miauen der Katze hinter der Tür anders erzählt. |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
 So entwickelte sich die Geschichte weiter. Walde thematisierte hier unterschiedliche psychische Zustände: die Klaustrophobie, beim Betreten eines engen Raums,
oder aber die Frustration, die man empfindet, wenn es einem nicht gelingt, die Tür
aufzuschließen. So entwickelte sich die Geschichte weiter. Walde thematisierte hier unterschiedliche psychische Zustände: die Klaustrophobie, beim Betreten eines engen Raums,
oder aber die Frustration, die man empfindet, wenn es einem nicht gelingt, die Tür
aufzuschließen. |
|
 |
AutorInnen: |
|
|
 |
Mami Kataoka |
 |
 |
  |
